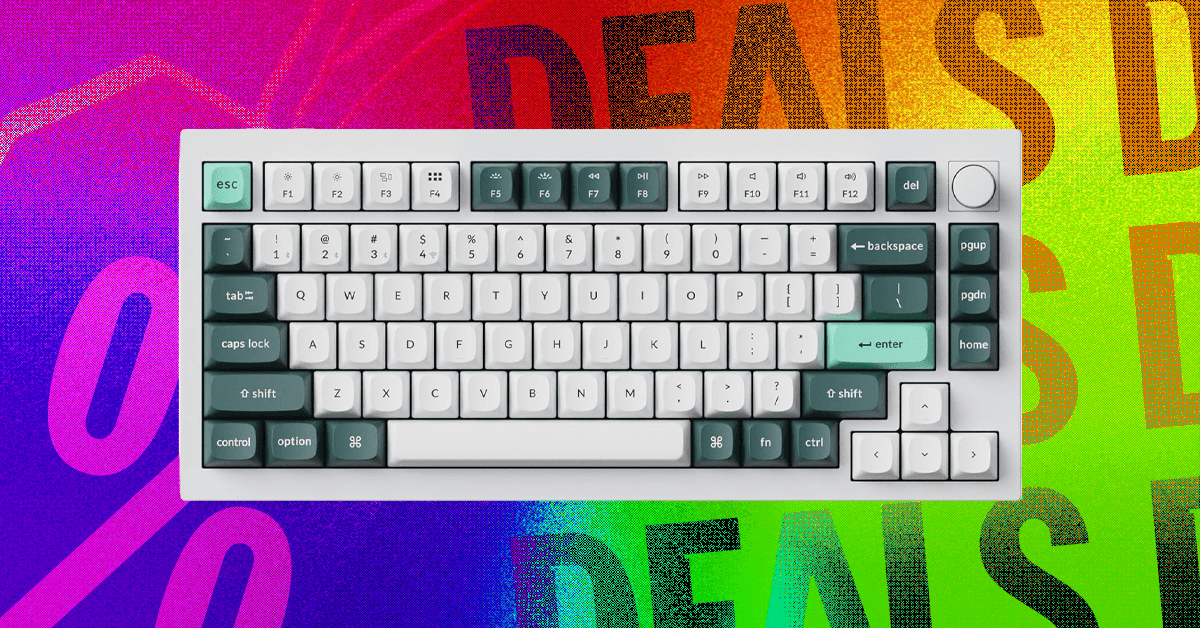Die Form der Akkretionsscheibe um ein Schwarzes Loch kann durch die Polarisation seiner Röntgenemission bestimmt werden.

Ein Astronomenteam des Sternberg Astronomical Institute der Moskauer Lomonossow-Universität entwickelte gemeinsam mit italienischen Kollegen eine neuartige Methode zur Bestimmung der Form von Akkretionsscheiben um Schwarze Löcher in Röntgendoppelsternen und aktiven Galaxienkernen durch Analyse des Polarisationsgrades ihrer Röntgenemission. Es stellte sich heraus, dass die Röntgenemission von Akkretionsscheiben empfindlich auf die Scheibenform reagiert und linear polarisiert sein sollte, wenn die Scheibe eine dünne „Pfannkuchen“-Form aufweist. Diese theoretischen Vorhersagen wurden durch Beobachtungen bestätigt: Die Methode wurde an mehreren Röntgendoppelsternen mit Schwarzen Löchern sowie an einer Seyfert-I-Galaxie getestet.
Kompakte kosmische Objekte wie Schwarze Löcher (BHs) bleiben trotz der Entdeckung zahlreicher „Schwarzlochkandidaten“, über die Astrophysiker kaum Zweifel haben, rätselhaft und im Wesentlichen hypothetisch (siehe beispielsweise die Pressemitteilung „ Das Schwarze Loch der Galaxie M87: Ein Porträt aus dem Inneren “, Elements, 14. April 2019). Ihre Forschung wirft zahlreiche Fragen auf, die unbeantwortet bleiben. So ist beispielsweise nicht klar, was in der unmittelbaren Umgebung von BHs geschieht. Insbesondere konnten Wissenschaftler bis vor Kurzem nur theoretische Vermutungen über die Form von Materiescheiben anstellen, die in BHs fallen (siehe das Problem „Scheibenakkretion “). Schon vor Jahrzehnten wurden verschiedene Theorien zur Struktur von Akkretionsscheiben vorgeschlagen, aber es fehlten noch immer experimentelle Daten, die es ermöglichten zu bestimmen, welche Theorie die Realität am besten beschreibt. Diese Situation änderte sich nach dem Start des Weltraumteleskops Imaging X-ray Polarimetry Explorer ( IXPE ), das Wissenschaftlern half, Daten zu gewinnen, die die Lehrbücher der Astrophysik revolutionieren könnten.
Akkretionsscheiben kommen in drei Hauptformen vor: als Zylinder, als Kugel und als dünner, flacher Pfannkuchen (Abb. 2). Erste Berechnungen sowjetischer Astrophysiker in den 1970er Jahren deuteten auf eine flache Form hin, doch diese Vermutung ließ sich damals nicht überprüfen: Teleskope und Datenanalysemethoden waren nicht in der Lage, so tief in die Umgebung Schwarzer Löcher vorzudringen.

Beobachtungen von Schwarzen Löchern mit dem IXPE haben bestätigt, was Wissenschaftler bisher nur vermutet hatten: Die Röntgenemission von Akkretionsscheiben ist polarisiert . Ihre Polarisation ist zudem linear und hängt von der optischen Dicke der Scheibe sowie ihrer räumlichen Ausrichtung ab. Letztere wurde bereits 1985 von den sowjetischen Physikern R. Sunyaev und L. Titarchuk auf der Grundlage theoretischer Berechnungen in strikter Übereinstimmung mit der relativistischen Strahlungstransporttheorie vorhergesagt (R. Sunyaev, L. Titarchuk, 1985. Comptonization of low-frequency radiation in accretion disks: Angular distribution and polarization of hard radiation ).
Nun haben Wissenschaftler der MSU die zuvor vorgeschlagene Beziehung zwischen Polarisationsgrad, optischer Dicke und dem Winkel zwischen der Scheibenebene und der Richtung des Beobachters verifiziert. Dazu nutzten sie eine breite Palette polarimetrischer Messungen und synchroner Spektralbeobachtungen der Weltraumteleskope NICER , NuSTAR und Swift . Wichtig ist, dass die Bestätigung der Beziehung zwischen Polarisation, Scheibendicke und ihrer Ausrichtung unmittelbar die Form der Akkretionsscheibe bestätigt: Sie ist „flach“! Aber der Reihe nach.
Bereits 1973 legten N. Shakura und R. Sunyaev eine bahnbrechende Idee zur Entstehung von Röntgenstrahlung in Doppelsternsystemen vor, die aus einem normalen Stern und einem kompakten Objekt (z. B. einem Schwarzen Loch, Abb. 3) bestehen. Diese Idee wird heute von der astronomischen Gemeinschaft weltweit allgemein akzeptiert. Der Kern der Idee liegt in der Freisetzung von Röntgenquanten während der Bildung einer Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch, wobei die Viskosität der vom Geberstern auf das Schwarze Loch fließenden Materie berücksichtigt wird (N. Shakura, R. Sunyaev, 1973. Schwarze Löcher in Doppelsternsystemen. Beobachtungserscheinungen ). Die Akkretionsscheibe ist ein riesiger „Whirlpool“ oder „Donut“ aus heißem Gas und kosmischem Staub, der entsteht, wenn Materie des Sterns von der enormen Schwerkraft des Schwarzen Lochs angezogen wird. Diese Materie fällt nicht direkt in das Schwarze Loch, sondern wirbelt darum herum, beschleunigt auf enorme Geschwindigkeiten und erhitzt sich auf Millionen von Grad. Es ist die wichtigste Informationsquelle über Schwarze Löcher und Astronomen können sein helles Licht nutzen, um deren Eigenschaften zu untersuchen.
Chandrasekhar kam 1946 erstmals zu dem Schluss, dass in Doppelsternsystemen eine Polarisation der Strahlung beobachtet werden kann (S. Chandrasekhar, 1946. Über das Strahlungsgleichgewicht einer Stellaratmosphäre ). Er zeigte, dass in einer planparallelen Atmosphäre mit Elektronenstreuung Strahlungstransport zu deren Polarisation führt. Chandrasekhars Lösung war jedoch auf reine Streuung in einer semi-unendlichen Atmosphäre ausgelegt und berücksichtigte weder die Scheibengeometrie noch die Streuung der Strahlung mit der Aufnahme von Photonenenergie (d. h. die Comptonisierung). R. Sunyaev und L. Titarchuk (in der oben erwähnten Arbeit von 1985) waren die Ersten, die die Winkel- und Raumverteilung der gestreuten Strahlung (über einen Zeitraum, der größer ist als die Mittelungszeit) für jede optische Tiefe berechneten.
Die Polarisation der Strahlung hängt von der Temperatur der Akkretionsscheibe und dem Ionisierungsgrad ihres Plasmas ab. Darüber hinaus hängt der Ionisierungszustand auch von der Dichte ab. Tatsächlich sendet eine klassische Akkretionsscheibe eine für einen perfekten schwarzen Körper charakteristische Strahlung aus (N. Shakura, R. Sunyaev, 1973. Schwarze Löcher in Doppelsternsystemen. Beobachtungserscheinung ). Diese Strahlung wird in der heißen Compton-Wolke wiederholt gestreut, und nur diese Strahlung wird bei Energien von 2 bis 8 keV gestreut (dies ist genau der Bereich, in dem IXPE die Polarisation misst). Das heißt, es ist diese Strahlung, die bei der Reflexion von der flachen Oberfläche der Scheibe eine Comptonisierung erfährt und gegenüber den physikalischen Parametern der Scheibe empfindlich ist (Abb. 3).

Was passiert in der Scheibe? Ist dort eine Polarisation der Röntgenstrahlung möglich? In der Scheibe befindet sich die gesamte Strahlung im thermischen Gleichgewicht und wird überhaupt nicht gestreut. Wird jedoch ein Schwarzkörperphoton emittiert, wird es sofort absorbiert (siehe G. Rybicki, A. Lightman, 1979. Radiative Processes in Astrophysics ). In der heißen Compton-Wolke werden Schwarzkörperphotonen jedoch tatsächlich gestreut und gewinnen dabei Energie.
Wie eingangs erwähnt, ist die Form der Akkretionsscheibe unter Astrophysikern seit langem umstritten. Verschiedenen Quellen zufolge kann sie kugelförmig, flach oder linsenförmig (konvex oder konkav) sein. Dies ist teilweise auf optische Beobachtungen der Polarisation der Röntgenstrahlung von Galaxien zurückzuführen, in denen sich Akkretionsscheiben um supermassereiche Schwarze Löcher bilden. Diese Beobachtungen erlaubten es jedoch nicht zu verstehen, wo die Polarisation der Röntgenstrahlung tatsächlich auftritt (im Bulge , in der Scheibe oder in einem anderen Teil der Scheibe) oder welche Form der Hauptpolarisator hat. Es stellte sich heraus, dass die äußeren Teile der Scheibe gewissermaßen ein Eigenleben führen und nicht aktiv an der Polarisation teilnehmen.
Interessanterweise behandelten frühere Modelle, die eine eher grobe Näherung verwendeten, die Scheibe als einen Zylinder mit flachen oberen und unteren Grenzen (eine „flache“ Scheibe). Dies liegt daran, dass rotierende Materie, die auf ein zentrales Objekt (z. B. ein Schwarzes Loch) fällt, unter dem Einfluss der Zentripetalkraft und der Gezeitenkräfte eine in der Rotationsebene verlängerte Scheibe bildet (diese Frage wird im Problem des „flachen“ Universums ausführlich behandelt).
Wie R. Sunyaev und L. Titarchuk (im selben Artikel von 1985) gezeigt haben, tritt die Polarisation der Röntgenemission eines Doppelsternsystems nur im inneren Teil der Scheibe (in der Compton-Wolke, CC) auf, wo die Wechselwirkung zwischen „kalter“ Strahlung und heißen Elektronen stattfindet. Darüber hinaus hängt der Polarisationsgrad vom Spektralzustand des Schwarzen Lochs ab: Er ist in einem Zustand hoher Leuchtkraft mit weichem Spektrum höher und in einem Zustand niedriger Leuchtkraft mit hartem Spektrum niedriger (Abb. 4; die Spektralzustände werden im Artikel „ Spektrale Signaturen zur Unterscheidung von Röntgendoppelsternsystemen mit Schwarzen Löchern und Neutronensternen“ ausführlich erörtert).

Der Vergleich theoretischer Berechnungen mit Beobachtungsdaten für eine Reihe von Röntgendoppelsternsystemen und aktiven Galaxienkernen bestätigte die Richtigkeit des beschriebenen Ansatzes und brachte auch Gewissheit hinsichtlich der Vielfalt der zuvor vorgeschlagenen Scheibenformmodelle, sodass nur noch die „flache Scheibe“ übrig blieb.
Tatsächlich zeigte ein einfacher Vergleich des mit IXPE gemessenen Polarisationsgrades \(P\), aufgetragen entlang der vertikalen Achse (Abb. 5, links), und des Scheibenneigungswinkels \(i\) (genauer \(cos i\)), aufgetragen entlang der horizontalen Achse (dieser Winkel ist aus Beobachtungen bekannt), für verschiedene Röntgendoppelsternsysteme mit Schwarzen Löchern, dass der Schnittpunkt dieser Größen in Übereinstimmung mit der Theorie für den Fall flacher Scheiben auf dem Graphen (dunkelgrüne Kurven) liegt. Und es gibt keine Schnittpunkte außerhalb der theoretisch berechneten Kurven. Darüber hinaus stimmt jede der Kurven, begleitet vom Wert der optischen Tiefe, wieder genau mit der theoretischen Vorhersage für den Fall einer flachen Scheibe überein. Das bedeutet, dass alle diese Scheiben flach sind!
Die erhaltenen Ergebnisse waren unerwartet, obwohl sie vor 40 Jahren vorhergesagt und dann aufgrund der Unmöglichkeit, den Polarisationseffekt durch Beobachtungen zu überprüfen, „beiseite gelegt“ wurden. Sie müssen berücksichtigt werden – dies wird zweifellos zu einer Überarbeitung vieler Akkretionsscheibenmodelle aufgrund möglicher Diskrepanzen mit Beobachtungsdaten führen. Dank der beschriebenen Ergebnisse können Astrophysiker nun den Polarisationsgrad bei der Berechnung der Parameter von Röntgenemissionsmodellen überprüfen. IXPE enthüllte die Geheimnisse der Polarisation und die Eigenschaften nicht nur von Schwarzen Löchern mit Sternmasse, sondern auch von supermassereichen Schwarzen Löchern, deren Strahlung während der Comptonisierung im heißen Plasma einer flachen Akkretionsscheibe ebenfalls linear polarisiert war. Die Abhängigkeit des Polarisationsgrads supermassereicher Schwarzer Löcher von der räumlichen Ausrichtung der Scheibe wurde bestätigt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die langjährige Theorie nun eine solide experimentelle Grundlage hat und die hier diskutierte Arbeit nicht nur alte Vermutungen bestätigt, sondern auch einen neuen Weg zur Untersuchung der extremsten Objekte im Universum eröffnet.
Quelle: Lev Titarchuk, Paolo Soffitta, Elena Seifina, Enrico Costa, Fabio Muleri, Romana Mikusincova. Vorhersage der linearen Röntgenpolarisation in Doppelsternen Schwarzer Löcher und aktiven Galaxienkernen und ihre Messungen durch IXPE // Astronomie und Astrophysik . 2025. DOI: 10.1051/0004-6361/202554834.
Elena Seyfina
elementy.ru