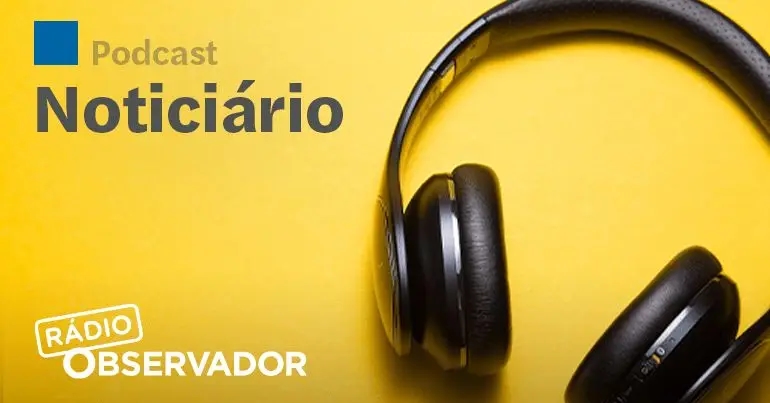Sind wir wirklich frei?

Freiheit nimmt derzeit einen nie dagewesenen zentralen Platz im modernen politischen Diskurs ein, ist aber gleichzeitig auch einer der am meisten missverstandenen und teilweise manipulierten Begriffe. Oft heißt es, wir seien frei, weil wir uns ausdrücken, bewegen können, wohin wir wollen, oder ohne Einschränkungen wählen können. Bei näherer Betrachtung wird jedoch klar, dass politische Freiheit nicht einfach bedeutet, zu tun, was wir wollen. Im Gegenteil, Freiheit ist vielmehr die Garantie, nicht zu etwas gezwungen zu werden, wozu wir kein Recht haben.
Montesquieu, einer der großen Architekten des modernen politischen Denkens, bietet uns eine Perspektive, die oberflächliche Vorstellungen von Freiheit in Frage stellt. Für ihn liegt wahre Freiheit in der Achtung der Gesetze, die das gesellschaftliche Zusammenleben regeln, in einer Rechtssicherheit, die individuelle Autonomie ohne Willkür gewährleistet. Frei zu sein bedeutet, innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen handeln zu können, die nicht dazu da sind, die Freiheit jedes Bürgers einzuschränken, sondern zu schützen.
Entgegen der landläufigen Vorstellung von Freiheit als uneingeschränkter Willensäußerung ist politische Freiheit auf solide Strukturen angewiesen, die den Einzelnen vor Missbrauch schützen, insbesondere im Justizsystem. Rechtssicherheit, insbesondere im Strafvollzug, ist ein Grundpfeiler. Ohne sie verliert sich die Freiheit in der Angst vor ungerechtfertigter Verfolgung, dem Mangel an Verfahrensgarantien und der Ungleichheit vor dem Gesetz. Unparteiische Justiz ist kein Luxus, sondern eine unabdingbare Voraussetzung für politische Freiheit.
Wir sind hier mit einer beunruhigenden Realität konfrontiert: Trotz ihrer Fortschritte gelingt es den heutigen Demokratien oft nicht, diese volle Freiheit zu gewährleisten. Willkür, die Langsamkeit des Systems, Ungleichheiten beim Zugang zur Justiz und politische Einflussnahme auf die Justiz gefährden die Sicherheit, die Freiheit real und spürbar macht. Ein Bürger, der unfairen Gerichtsverfahren ausgesetzt ist, kann paradoxerweise weniger frei sein als jemand unter einem autoritären Regime, das zumindest ein Mindestmaß an Rechtssicherheit gewährleistet.
In der aktuellen öffentlichen Debatte beobachten wir eine starke Verwechslung zwischen politischer Freiheit und absoluter Freiheit, als wäre das Recht, zu tun, was man will, gleichbedeutend mit Freiheit. Doch eine solche Freiheit existiert in einer organisierten Gesellschaft nicht. Rechtsstaatlichkeit ist kein Hindernis für den individuellen Willen, sondern vielmehr eine Garantie dafür, dass der Wille jedes Einzelnen nicht durch die Willkür anderer, sei es durch Herrscher oder gesellschaftliche Gruppen, unterdrückt wird. Nur in diesem Rahmen klarer Gesetze und unabhängiger Justiz kann Freiheit wirklich gedeihen.
Einige Fragen bleiben offen: Inwieweit sind wir bereit, die Grenzen und die Verantwortung zu akzeptieren, die politische Freiheit mit sich bringt? Wie viele erkennen, dass Freiheit nicht bedeutet, zu tun, was man will, sondern sicherzustellen, dass niemand zu etwas gezwungen wird, was er nicht tun möchte? Sind wir bereit, Institutionen zu verteidigen, die Rechtssicherheit garantieren, selbst wenn dies dem momentanen Wunsch nach Straflosigkeit oder uneingeschränkter Freiheit widerspricht?
Wahre Freiheit ist kein Gefühl; sie ist ein konkreter Zustand, der auf Regeln, Gerechtigkeit und gegenseitigem Respekt beruht. Wenn wir nicht aufpassen, laufen wir Gefahr, Freiheit zu einem bloßen Schlagwort zu reduzieren, einer Maske, hinter der sich willkürliche und instabile Macht verbirgt. Wahre Freiheit beginnt mit dem Gesetz, und auf dieser Grundlage müssen wir unseren Kampf ausrichten.
Es ist entscheidend zu erkennen, dass demokratische Errungenschaften fragil sind und ständiger Wachsamkeit bedürfen. Politische Freiheit ist alles andere als selbstverständlich und hängt von einer institutionellen Architektur ab, die nicht nur faire Gesetze schafft, sondern diese auch gerecht und transparent durchsetzt. Die aktuelle Herausforderung besteht darin, diese Institutionen gegen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Druck zu verteidigen, der ihre Rolle zu untergraben versucht. Ohne eine unabhängige Justiz und ein verlässliches Rechtssystem wird das, was wir Freiheit nennen, zur Illusion.
Darüber hinaus ist die politische Freiheit in der heutigen Welt neuen und komplexen Bedrohungen ausgesetzt: Der Fortschritt digitaler Technologien, die Verbreitung von Desinformation und die zunehmende Polarisierung können den öffentlichen Raum untergraben und den Konsens der Bevölkerung manipulieren. Die Verteidigung der Freiheit bedeutet daher auch, ein demokratisches Umfeld zu schützen, in dem Debatten nach klaren Regeln und unter Achtung der Grundrechte stattfinden. Das Recht muss in diesem Zusammenhang angepasst werden, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden und sicherzustellen, dass Freiheit nicht in Chaos oder Tyrannei der Mehrheit umschlägt.
Letztlich ist die vorgeschlagene Reflexion kein Aufruf zum Pessimismus, sondern ein Appell zu bürgerschaftlicher Verantwortung und dem Aufbau einer reifen und nachhaltigen Freiheit. Es ist unerlässlich, vereinfachende Narrative aufzugeben und ein tieferes Verständnis zu suchen, das die Balance zwischen individuellen Rechten und dem Gemeinwohl in den Vordergrund stellt. Nur so kann politische Freiheit ihr Versprechen wirklich erfüllen – nicht als Fantasie grenzenloser Autonomie, sondern als lebendige, greifbare Realität für alle.
observador