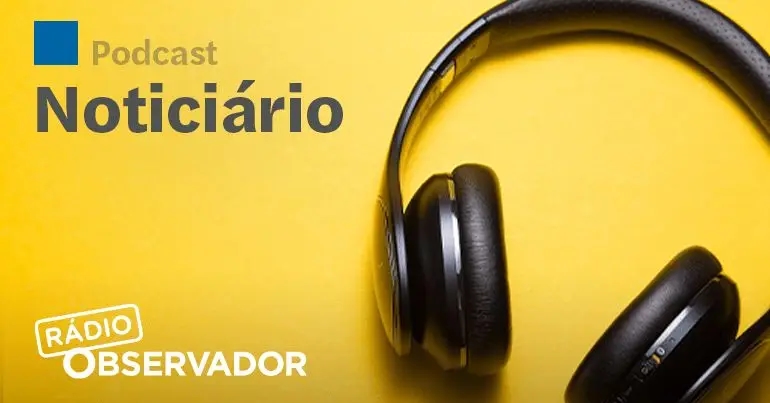Sind wir bereit, dieses Gespräch zu führen?

Es gibt nur wenige Wörter, die so viel kollektive Aufregung auslösen wie „Steuern“. Man muss es sagen, und innerhalb von Sekunden gerät man in eine existenzielle Krise: „Wir zahlen zu viel!“, „Der Staat stiehlt uns aus!“, „Und dann sind es nur noch Arbeitsplätze!“ Dieser nationale Aufschrei hat etwas Machiavellistisches. Und ich verstehe das. Aber er hat auch etwas zutiefst Naives. Denn seien wir ehrlich: Wenn es etwas gibt, das uns als Gesellschaft wirklich eint – neben unserer Liebe zum Kaffee und unserem Hass auf VAR –, dann ist es die bequeme Vergesslichkeit, dass wir seit unserer Geburt von Dingen umgeben sind, die mit … Steuern bezahlt werden.
Die Debatte über die Steuerlast steht erneut auf der Tagesordnung. Schließlich ist es einfacher, die Schuld für die Kontostände dem Finanzamt zuzuschieben, als darüber nachzudenken, wie wir die Effizienz des Staates steigern können.
Ja, es tut mir leid, den Mythos vom Selfmademan zu zerstören, aber die Geburt in einem öffentlichen Krankenhaus, die Impfungen im Gesundheitszentrum, die kostenlosen Schulbücher, der Schulweg und sogar der Lehrer, der uns beibrachte, dass Camões keine App ist – all das wurde mit den Steuern aller finanziert. Und ich wiederhole: mit den Steuern aller. Es war keine Zauberei. All das existiert, weil es Steuern gibt.
Die Art und Weise, wie in Portugal heute über Steuern diskutiert wird, wirkt jedoch wie aus einem Märchen: „Die Steuern müssen jetzt gesenkt werden! Dringend! Schnell!“, heißt es. Und ich frage: Wie geht es weiter? Sollen wir die Ausgaben kürzen? Sollen wir das System reformieren? Oder sollen wir einfach anfangen, die Rechnungen vollständig zu bezahlen? Denn die Frage kann nicht nur lauten: „Wie senken wir die Steuern?“, sondern: „Wie machen wir den Staat effizienter, damit die Steuern, die wir zahlen, auch wirklich Sinn machen?“ Das wäre eine Debatte im Sinne des öffentlichen Dienstes.
Über die Jahre haben wir Investitionen mit Ausgaben und Reformen mit Kürzungen verwechselt. Das Gesundheitswesen ist dafür ein hervorragendes – vielleicht sogar das beste – Beispiel. Jahr für Jahr haben wir das Gesundheitsbudget erhöht, doch die Wartezeiten für Termine und Operationen füllen weiterhin Zeitungen und Wartezimmer. Warum? Weil man zu lange dachte, das Problem sei Geldmangel und nicht Organisation. Ein ineffizientes System mit Geld zu überschütten, ist wie einen undichten Eimer zu füllen: Egal, wie sehr man es versucht, man wird ihn nie füllen können.
Aber was lief schief? Die Reform lief schief. Der Mut, die öffentliche Verwaltung zu hinterfragen und zu erkennen, dass Dienstleistungen mehr als nur Budgets erfordern, fehlte. Sie brauchen Ziele, Vorgaben, Kennzahlen und, nun ja, ein Gefühl der Dringlichkeit. Produktivitätsanreizsysteme? Tolle Idee. Teams belohnen, die ihre Ressourcen gut verwalten? Klingt vernünftig. Leistungsmessung? Innovativ, in der heutigen Welt fast revolutionär. Rechenschaftspflicht und Effizienz sind keine Feinde des Wohlfahrtsstaates. Sie sind seine besten Verbündeten. Denn ein verschwenderischer Staat, egal wie gerecht er auch sein mag, ist nicht mehr ethisch.
Es liegt also ein schwerwiegendes Generationenversagen darin vor, die jüngeren Generationen über die Rolle von Steuern in der Gesellschaft aufzuklären. Wir sprechen mit ihnen über Rechte, vergessen aber über Pflichten. Wir zeigen ihnen die Leistungen, verstecken aber die Rechnung. Wir machen sie zu Konsumenten des Staates, aber nicht zu Bürgern, die sich seiner Erhaltung bewusst sind. Und so setzen wir Jahr für Jahr den Kreislauf fort: Wir fordern mehr, zahlen widerwillig und protestieren aus tiefstem Herzen, aber ohne Grund.
Das Kuriose daran ist, dass viele junge Portugiesen sagen, sie wollten das Land wegen der „Steuerlast“ verlassen. Doch dann entscheiden sie sich für die Auswanderung in Länder wie Schweden oder Deutschland – wo die Steuerlast, stellen Sie sich vor, noch höher ist. Aber was gibt es denn schon, was wir hier nicht haben? Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, die pünktlich kommen, Warteschlangen, die nicht drei Winter dauern, zugängliche und hochwertige öffentliche Universitäten und Dienstleistungen, die mit einer fast langweiligen Vorhersehbarkeit funktionieren. Mit anderen Worten: In diesen Ländern protestieren die Menschen nicht gegen die Zahlung von Steuern … weil klar ist, wohin sie gehen.
Hier herrscht ein anderes Gefühl: Wir zahlen viel, sehen wenig und werden oft für Leistungen, die uns angeblich zustehen, gleichgültig behandelt. Die Folge? Es entsteht eine Kultur des Misstrauens gegenüber dem Staat, als läge das Problem im Konzept der Beiträge selbst und nicht in ihrer Verwaltung. Die schwerwiegendste Folge davon? Eine Generation wächst auf, die Steuern eher als Raub denn als kollektive Investition betrachtet.
Und genau hier müssen wir einen Wandel herbeiführen. Es geht nicht um die Höhe der Steuern, sondern um ihre Umsetzung in hochwertige öffentliche Güter. Wir brauchen eine öffentliche Verwaltung, die sich als Motor der Entwicklung versteht, nicht als festgefahrenes Getriebe. Wir brauchen Führungskräfte mit der nötigen Ausbildung, Vision und dem Mut zu Reformen. Und wir brauchen dringend einen nationalen Effizienzpakt, der unser Vertrauen in die Sinnhaftigkeit unseres Beitrags wiederherstellt.
Denn ehrlich gesagt: Niemand zahlt gerne für mittelmäßigen Service. Aber niemand hat etwas dagegen, zu investieren, wenn er das Gefühl hat, etwas Eigenes aufzubauen. Steuern sind nicht der Bösewicht. Verschwendung ist der wahre Dieb.
observador