Eine liberale Kritik am Versuch, Chega aufzulösen.
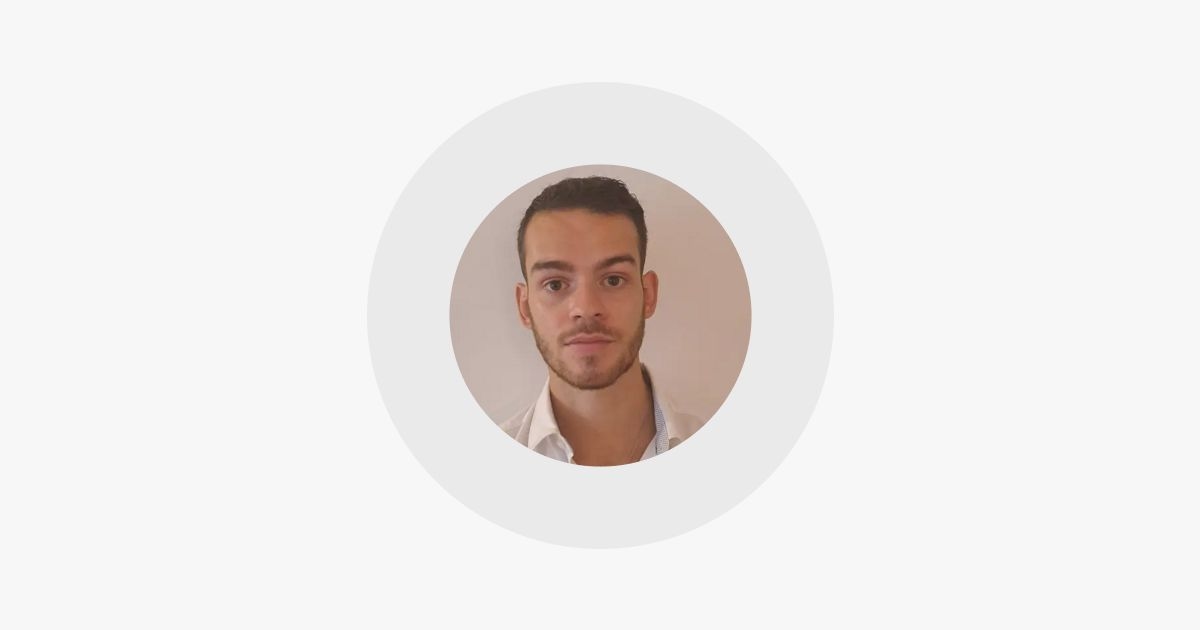
Im Oktober 2025 erstattete der Anwalt António Garcia Pereira Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und beantragte die Auflösung der Partei Chega gemäß Artikel 46 Absatz 4 der Verfassung der Portugiesischen Republik. Seiner Ansicht nach verstieß die Partei gegen grundlegende Prinzipien der verfassungsmäßigen Ordnung, indem sie Hassreden und Ideologien verbreitete, die der Menschenwürde zuwiderliefen.
Dieser Fall ist eher symbolischer als juristischer Natur: Er zwingt uns, die Grenzen der politischen Freiheit und die innere Kohärenz eines Systems zu überdenken, das sich selbst als demokratisch und pluralistisch bezeichnet, gleichzeitig aber bestimmte Formen ideologischer Organisation verbietet. Wenn politische Freiheit, wie man sagt, eine der Säulen der Demokratie ist, inwieweit darf der Staat dann entscheiden, welche Ideale zulässig sind?
Die Verfassung garantiert weitreichende Grundrechte und -freiheiten, von denen viele jedoch durch ausdrücklich in der Verfassung selbst festgelegte Beschränkungen oder restriktive Auslegungen des Verfassungsgerichts eingeschränkt werden können. Im vorliegenden Fall geht es um eine Beschränkung der zweiten Kategorie.
Die in Artikel 46 anerkannte Vereinigungsfreiheit wird insbesondere durch Absatz 4 eingeschränkt, der besagt: „Bewaffnete Vereinigungen, militärische, militarisierte oder paramilitärische Vereinigungen sowie rassistische Organisationen oder solche, die faschistische Ideologie vertreten, sind nicht zulässig.“ Diese Regelung hat einen klaren historischen Ursprung: das Trauma des Estado-Novo-Regimes (Neuer Staat) und die Angst vor einer möglichen Rückkehr zum Autoritarismus.
Diese Ausnahme offenbart jedoch ein Paradoxon: Um die Freiheit zu schützen, akzeptiert die Verfassung deren Einschränkung. Die Demokratie wird somit zu einem System, das präventiv nicht nur gegen Gewaltakte, sondern auch gegen Ideen vorgeht. Dies nannte Karl Popper das „Paradoxon der Toleranz“: die Notwendigkeit, Intoleranz nicht zu tolerieren, um eine offene Gesellschaft zu bewahren.
Doch inwieweit ist es legitim, dass der Staat diese paternalistische Rolle einnimmt und entscheidet, was Bürger politisch verteidigen dürfen und was nicht?
Aus politikwissenschaftlicher Sicht lässt sich Chega nicht eindeutig als faschistische Partei einordnen. Der historische Faschismus – als revolutionäre totalitäre Bewegung – setzte die Abschaffung des Pluralismus, die „Verstaatlichung“ des Staates, den Gewaltkult und die Ablehnung der „repräsentativen Demokratie“ voraus.
Die Chega ist ihrerseits eine rechtsnationalistische Partei, die innerhalb des parlamentarischen Systems und im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit agiert und deren Ideologie eher moralisch und sicherheitsorientiert als totalitär ist. Ihre Positionen zu Einwanderung, Minderheiten oder Kriminalität mögen kontrovers und sogar demagogisch erscheinen, stellen aber kein Projekt zur Zerstörung der Demokratie dar.
Ein Verbot seiner Existenz wäre daher ein konzeptioneller und politischer Fehler: Es würde radikale Kritik am System mit dem Versuch verwechseln, es zu stürzen – etwas, das in der liberalen Tradition mit Argumenten und nicht mit Verboten bekämpft werden muss.
Der klassische Liberalismus basiert auf der Idee, dass die Meinungsfreiheit dann eingeschränkt werden sollte, wenn sie anderen tatsächlich Schaden zufügt. Ideen oder Worte allein zu bestrafen, ist mit einem wahrhaft freien Staat unvereinbar.
Die gegenwärtige Ausweitung des Begriffs „Hassverbrechen“ spiegelt eine moralisierende Entwicklung im Strafrecht wider – ein „Gefühlsstrafrecht“, das symbolische Vergehen in Straftaten gegen die öffentliche Ordnung umwandelt. Ein liberaler Staat existiert nicht, um seine Bürger vor Kränkungen zu schützen, sondern um ihr Leben und Eigentum vor realem Schaden zu bewahren.
Selbst wenn eine Partei provokative Rhetorik verwendet, sollte die legitime Grenze der Bestrafung daher die Handlung und nicht die Absicht sein. Worte zu bestrafen ist der erste Schritt zur Bestrafung von Gedanken.
Interessanterweise verbietet die Verfassung zwar faschistische Organisationen, nicht aber kommunistische, obwohl die Geschichte zeigt, dass beide Bewegungen zu totalitären Regimen geführt haben. Die portugiesische Kommunistische Partei, die sich als Erbe einer Ideologie versteht, die für Millionen Tote und die Unterdrückung von Rechten und Freiheiten verantwortlich ist, ist eine vollkommen legitime Kraft im portugiesischen politischen System.
Die zeitgenössische „liberale Demokratie“ präsentiert sich als ein System der Freiheit, Pluralität und ideologischen Neutralität. Betrachtet man jedoch ihre Praxis, so zeigt sich, dass diese Neutralität oft nur scheinbar ist.
Wie Carl Schmitt feststellte, beruht jede politische Ordnung auf einer grundlegenden Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Die Demokratie, in ihrem scheinbaren Bestreben nach Universalität und Inklusivität, schafft letztlich ihre eigenen inneren Feinde – jene, die „ihre Werte nicht teilen“. Paradoxerweise verteidigt die „liberale Demokratie“ die Freiheit, indem sie diejenigen ausschließt, die sie anders interpretieren.
Derselbe Staat, der Gedankenfreiheit proklamiert, definiert gleichzeitig, welche Gedanken akzeptabel sind. Der institutionalisierte Faschismus verwandelt sich so in eine Art offizielles Dogma – eine moderne Religion, in der bestimmte politische Überzeugungen heilig und andere ketzerisch sind.
Dieser Trend ist nicht auf Portugal beschränkt. In ganz Europa hat sich der rechtliche und kulturelle Antifaschismus zu einem Instrument moralischer Konformität entwickelt, das dazu dient, die Grenzen des Akzeptablen zu definieren und abweichende Meinungen zu unterdrücken. Das Ergebnis ist eine Demokratie, die im Namen der Toleranz zunehmend moralisiert, weniger rational und intoleranter wird.
Wie bereits erwähnt, argumentierte Karl Popper, dass eine tolerante Gesellschaft intolerante Menschen nicht dulden könne, da diese sich sonst selbst zerstören würden. Diese These wird häufig zur Rechtfertigung des Verbots extremistischer Bewegungen herangezogen.
Doch es gibt ein Problem: Wer definiert, wer „intolerant“ ist? Wenn politische Macht dieses Kriterium anwendet, öffnet dies die Tür für einen moralischen Absolutismus, bei dem jede radikale Opposition als „antidemokratisch“ abgestempelt werden kann.
Hannah Arendt zeigte in ihren Untersuchungen totalitärer Regime, dass die Gefahr nicht nur in der Ideologie liegt, sondern auch in der Vermischung von Moral und Politik – wenn der Staat beginnt, abweichendes Denken im Namen des Gemeinwohls zu bestrafen. In diesem Sinne riskiert der europäische antifaschistische Konstitutionalismus bei dem Versuch, das Böse zu verhindern, dessen Mechanismen zu reproduzieren: Zensur, Überwachung und die Bestrafung von Ideen.
Wenn wir wirklich an politische Freiheit glauben, dann müssen wir auch das Recht eines jeden akzeptieren, antidemokratisch zu sein – solange er nicht zu Gewalt greift.
Freiheit, die Irrtümer ausschließt, ist eine Scheinfreiheit. Demokratie, die ihre Negation nicht duldet, ist im Kern eine Tyrannei der guten Manieren.
In einem wahrhaft liberalen Staat wird der Kampf gegen extreme Ideen durch Debatten geführt, nicht durch gerichtliche Verfahren. Es ist die Argumentation, nicht das Gericht, die den politischen Gegner besiegen sollte.
Die Auflösung von Chega (oder irgendeiner anderen Partei) auf der Grundlage moralischer Kriterien wäre ein Pyrrhussieg für die Demokratie – die Demokratie würde zwar siegen, aber ihre Seele ginge verloren.
Der Antrag auf Auflösung von Chega stellt mehr als nur eine juristische Episode dar: Er spiegelt ein tiefgreifendes Dilemma der modernen Demokratie wider.
Die portugiesische Verfassung, die faschistische Ideologien verbietet und kommunistische Ideologien zulässt, zeigt, dass staatliche Neutralität eine nützliche Fiktion ist. Und indem sie Hassrede bestraft, ohne dass tatsächlicher Schaden entsteht, riskiert sie, Freiheit in ein bedingtes Privileg zu verwandeln.
Die portugiesische liberale Demokratie, geboren aus der Angst vor der Vergangenheit, lebt noch immer im Schatten dieses Traumas – sie schützt sich so sehr, dass sie vergisst zu atmen.
Vielleicht liegt der wahre Prüfstein demokratischer Reife darin, selbst Kritiker zuzulassen. Denn, wie Mill uns in Erinnerung rief: „Die Wahrheit entsteht aus dem Aufeinandertreffen der Meinungen, nicht aus dem Schweigen der einen im Namen der anderen.“
observador




