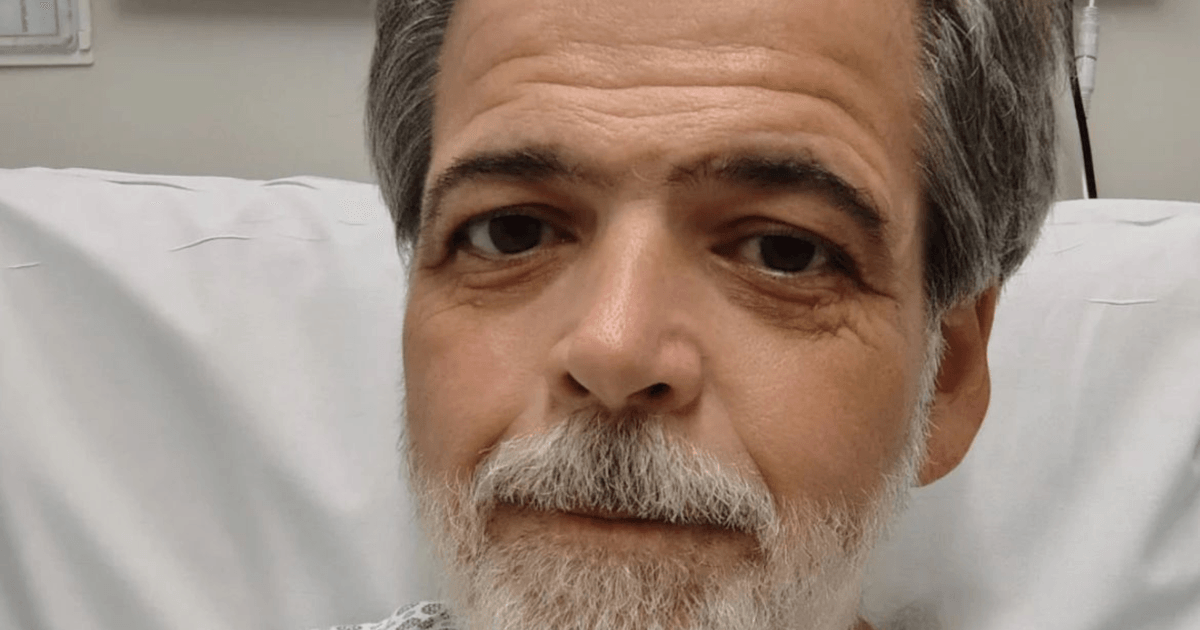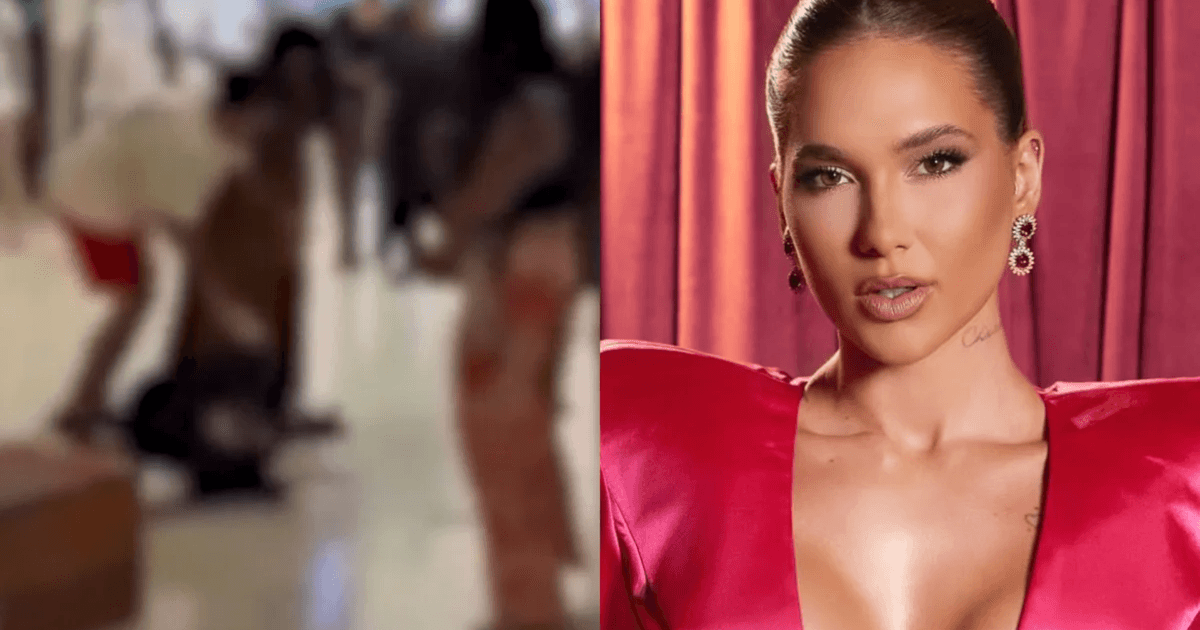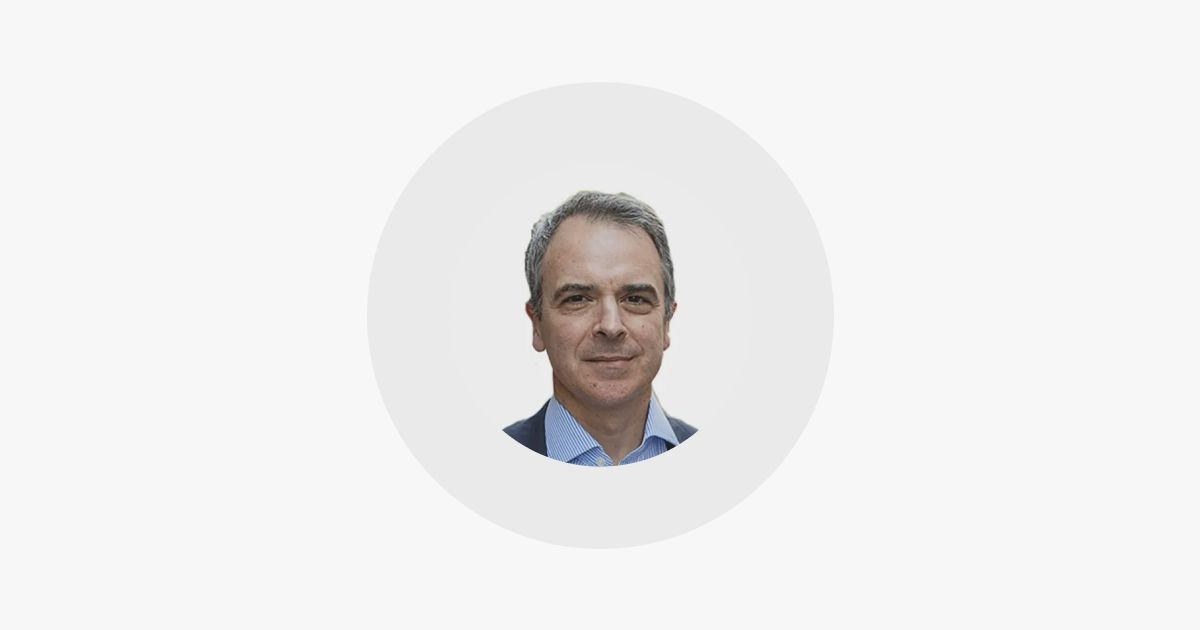Ein Land, das auf den Kopf gestellt wurde
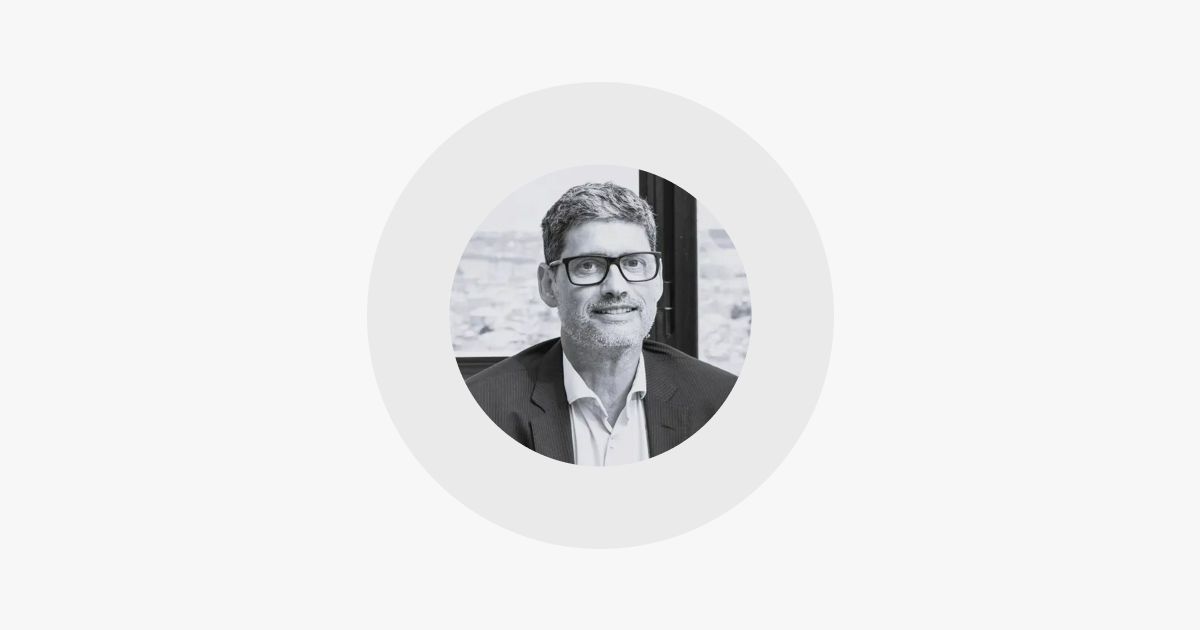
Aufgrund meiner offensichtlichen Unfähigkeit und meiner seltenen Neigung zur Nachlässigkeit war mein Studium ein einziges Desaster. Und dass ich heute überhaupt noch studiere, verdanke ich meinen Fehlern. Und mit Fehlern meine ich nicht die Art von Fehlern, bei denen man denkt: „Wie ärgerlich, das muss ich nochmal machen“, sondern eher: „Oh nein, was für ein Chaos, wie soll ich das bloß wieder hinkriegen?“
Eines Tages schrieb ich an dieser Stelle darüber, was Kapital ist. Die meisten Menschen verbinden dieses Wort sofort mit Geld. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Kapital ist die Fähigkeit, etwas zu produzieren, das andere konsumieren möchten. Ein Land kann viel Geld, aber wenig Kapital besitzen – etwas, das häufig bei Ölförderländern vorkommt, die darauf bestehen, die besten Produkte aus dem Ausland zu kaufen, anstatt sie selbst herzustellen. Das heißt, die Produktionsfähigkeit hängt kaum von der Größe unseres Bankkontos ab, sondern vielmehr von unserem Können. Betrachtet man also die Vermögensstatistik, so findet man neben Ölproduzenten und Freihandelszentren Länder wie Dänemark, Finnland oder die Niederlande, die nichts anderes zu verkaufen haben als die Produktivität ihrer Bevölkerung.
Was diese Länder aus Felsen, Eis und Bäumen anderen voraus haben, ist das Verständnis dafür, wie wichtig es ist, diese Handlungsfähigkeit in ihr einziges Kapital – ihre Bevölkerung – zu integrieren. Das Kapital eines Landes liegt in der Bildung und ihrer Qualität. Natürlich gibt es Länder, die fast im völligen Müßiggang leben können, solange ihre natürlichen Ressourcen es zulassen. Solange Öl aus dem Boden sprudelt, können Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate sich jedes beliebige Bildungssystem leisten (obwohl sie in das Gegenteil investieren). Solange Sonne und Strände da sind, kann Portugal weiterhin Horden von Müßiggängern fördern, die von Steuern leben, die von schüchternen Touristen in Socken und Sandalen erhoben werden.
Abgesehen von jenen Ländern mit diesen natürlichen Privilegien, deren Einwohner sie sich einfach erworben haben, gibt es andere, die wirklich reichen Länder, die jeder beneidet, in denen es scheint, als seien die „natürlichen Privilegien“ den Menschen angeboren. Doch dem ist nicht so; es gibt keinen biochemischen Vorteil, in Schweden, den Niederlanden oder der Schweiz geboren zu sein. Es gibt den Vorteil der historischen Erkenntnis, dass Kapital, diese Produktionsfähigkeit, von Mensch zu Mensch, von Alt zu Jung weitergegeben wird. Was wir gemeinhin Bildung nennen.
Wenn es bei Bildung nur um Wissensvermittlung ginge, wäre es einfach. Man müsste die Kinder nur vor Wikipedia, YouTube und ChatGPT setzen, und schon ließe sich ihnen das gesamte Wissen der Welt vermitteln. Doch Bildung bedeutet nicht Wissensvermittlung, sondern die Vermittlung von Kapital, was viel schwieriger ist. Es geht nicht ums Wissen, sondern darum, Fehler zu machen.
Irren ist die Grundlage allen Kapitals, und deshalb brauchen wir menschliche Erzieher; unendliche Wissensquellen nützen uns nichts. Hätte es dem Leser etwas gebracht, das Mathebuch mit nach Hause zu nehmen und zu lesen, wenn er die Übungen darin nicht gemacht hätte? Es ist ja kein kompliziertes Buch; jedes Kind, das lesen kann, würde es sicher schnell durchlesen. Doch es würde keine Mathematik verstehen, weil es nie einen Fehler gemacht hätte.
Wenn wir einen Klempner engagieren, dann nicht wegen seines Fachwissens, sondern wegen seiner Fehler. Dasselbe gilt für Klempner, Berater, Anwälte und viele andere. Wissen kaufen wir nicht; das findet man kostenlos im Internet. Wir kaufen vielmehr all die Fehler, die diese Menschen in ihrem Leben gemacht haben. Gäbe es keine Fehler, würden Karrieren nicht auf dem Aufstieg von der Schule nach oben beruhen, sondern auf dem Fallen von der Schule nach unten, da wir nach und nach immer weniger Wissen erhalten.
Und all dieser Wirbel um eine Nachricht, wonach 28 Forscher der Fakultät für Naturwissenschaften und Technologie der Nova Universität Lissabon – darunter Professorin Elvira Fortunato, die ihre wissenschaftliche Karriere leider für eine weniger lukrative Stelle im öffentlichen Dienst unterbrach – angeblich gegen ihren Exklusivitätsvertrag mit der Universität verstoßen haben, von der sie höhere Gehälter beziehen. Anders gesagt: Wer festangestellt an der Fakultät ist, verdient mehr als wer nicht. Das Merkwürdige an den öffentlichen Reaktionen, einschließlich derer einiger Akademiker mit einer eher bürokratischen Denkweise, war die heftige Verurteilung dieser 28 Forscher, ohne zu begreifen, wie absurd das Ganze ist.
Ein Universitätsprofessor/Forscher ist ein Repräsentant der Hochschulbildung, der möglichst viele Fehler weitergeben sollte. Von ihm wird erwartet, dass er Erfahrung und Bezug zur wirtschaftlichen Realität besitzt und die Welt bereist – sowohl geografisch als auch wirtschaftlich –, um zu experimentieren und Fehler zu machen. Emy Edmonson, Harvard-Professorin und Forscherin zum Thema Fehler als Managementelement, hat ein sehr gutes Buch mit dem Titel „The Right Kind of Error“ (Hrsg. Temas e Debates) geschrieben. Darin charakterisiert sie Forscher als die natürlichen Vermittler des richtigen Fehlers, also des Fehlers, der neues Wissen liefert, aber vor allem die Erkenntnis, dass es „nicht so ist“. Genau das rechtfertigt es, den Klempner zu bezahlen, aber mehr als zu wissen, was ist, geht es darum zu wissen, was nicht ist. Was nicht ist, steht in keinem Buch; wir brauchen den Klempner, um es uns auf seine Weise beizubringen.
Was macht dieses Land? Es belohnt den regelkonformen Professor/Forscher, der zum bloßen Beamten degradiert wird. Je engagierter sie sich in ihrem Staatsdienst engagieren, desto mehr verdienen sie. Wenn sie jedoch auf die Straße gehen und einen Fehler begehen, neue Forschungsgebiete erkunden oder einen wirtschaftlichen Nutzen in ihren Untersuchungen entdecken, werden sie für diese Todsünde bestraft. „Du wirst keinen wirtschaftlichen Wert haben“ – dies scheint das erste Gebot zu sein, das die portugiesische Republik ihren Beamten einimpft.
Portugal ist nicht zufällig oder aus Pech arm. Im Gegenteil, es hat großes Glück mit den natürlichen und politischen Gegebenheiten, die es der einen Hälfte des Landes ermöglichen, von der Sonneneinstrahlung und der anderen Hälfte von deutscher Wohltätigkeit zu leben. Portugal ist arm, weil es die Armut verdient hat. Ohne die Details der Forschungsprojekte von Professorin Elvira Fortunato und ihrem Team zu kennen, würde ich die Summe des generierten Kapitals auf mehrere zehn Millionen Euro schätzen, das vollständig von externen Geldgebern finanziert wurde. Und nun wird beschlossen, sie und ihre 28 Kollegen dafür zu bestrafen, dass sie sich nicht mit ein paar Vorlesungen über Mechanik des 18. Jahrhunderts begnügten, sondern in die Welt hinausgingen, um Neues zu entdecken, Fehler zu machen und Kapital zu generieren.
Nein, meine unwissenden Mitbürger, diejenigen, die (deutlich) weniger erhalten sollten, sind diejenigen mit Exklusivität. Und außerdem sollten wir hinterfragen, warum gerade diese Menschen auf Exklusivität beschränkt sind. Diese Menschen zu bestrafen, was wohl das Gesetz vorschreibt (ich selbst besitze offensichtlich keine Exklusivität), ist ein Zeichen für ein Land, das völlig rückständig ist.
Wenn ich heute den Anspruch erheben kann, meinen jungen, zukünftigen Kollegen etwas beibringen zu können, wenn ich heute in einem Unternehmen und an einer Universität theoretische Forschung betreiben kann, dann verdanke ich das den Fehlern, die ich in meinem Berufsleben gemacht habe. Wäre ich ein Musterschüler gewesen, der nie einen Fehler gemacht hätte, hätte ich eine Karriere als fehlerloser Mensch eingeschlagen und wäre an einer portugiesischen Universität mit einer herausragenden Auszeichnung dafür belohnt worden, dass ich weiterhin keine Fehler mache. Und ich hätte keinerlei produktiven Wert gehabt. Absolut keinen.
Gast des Freedom Workshop
observador