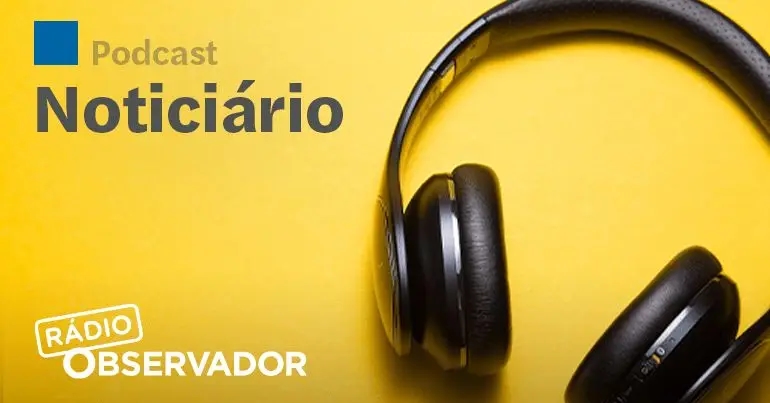Im Kloster der tibetischen Mönche, die versuchen, China Widerstand zu leisten

In eine karmesinrote Robe gehüllt, Gebetsperlen gleiten rhythmisch durch seine Finger, kommt der Mönch auf uns zu.
Es ist eine riskante Entscheidung.
Wir werden von acht unbekannten Männern verfolgt. Schon ein paar Worte an unser Reporterteam in der Öffentlichkeit könnten uns Ärger einbringen.
Doch er scheint bereit, das Risiko einzugehen. „Die Dinge hier stehen nicht gut für uns“, sagt er ruhig.

Dieses Kloster in der südwestchinesischen Provinz Sichuan ist seit Jahrzehnten ein Zentrum des tibetischen Widerstands. Die Welt erfuhr erstmals Ende der 2000er Jahre davon, als sich Tibeter dort aus Protest gegen die chinesische Regierung selbst anzündeten. Fast zwei Jahrzehnte später gibt das Kirti-Kloster in Peking immer noch Anlass zur Sorge.
Direkt am Haupteingang wurde eine Polizeistation errichtet. Sie liegt neben einem kleinen, dunklen Raum voller knarrender Gebetsmühlen. Überwachungskameras auf Stahlmasten umgeben den Komplex und überwachen jeden Winkel.
„Sie haben kein gutes Herz, das sieht jeder“, fügt der Mönch hinzu. Dann folgt eine Warnung. „Seien Sie vorsichtig, sie beobachten Sie.“
Als die Männer, die uns gefolgt waren, angerannt kommen, tritt der Mönch zurück.

„Sie“ sind die Kommunistische Partei Chinas, die seit der Annexion der Region im Jahr 1950 fast 75 Jahre lang über sechs Millionen Tibeter herrscht.
China hat massiv in die Region investiert und neue Straßen und Eisenbahnen gebaut, um den Tourismus anzukurbeln und die Region mit dem Rest des Landes zu verbinden. Geflohene Tibeter berichten, dass die wirtschaftliche Entwicklung auch zu mehr Truppen und Behörden geführt und so ihren Glauben und ihre Freiheit eingeschränkt habe.
Peking betrachtet Tibet als integralen Bestandteil Chinas. Den im Exil lebenden geistlichen Führer Tibets, den Dalai Lama, bezeichnet es als Separatisten. Wer sein Bild zeigt oder ihn öffentlich unterstützt, könnte hinter Gittern landen.
Dennoch haben einige in Aba (auf Tibetisch Ngaba, der Heimat des Klosters Kirti) extreme Maßnahmen ergriffen, um diese Beschränkungen zu missachten.

Die Stadt liegt außerhalb der chinesischen Autonomen Region Tibet (TAR), die 1965 gegründet wurde und etwa die Hälfte des tibetischen Hochlandes umfasst. Millionen Tibeter leben jedoch außerhalb der TAR und betrachten den Rest als Teil ihrer Heimat.
Aba spielt seit langem eine entscheidende Rolle. Während des tibetischen Aufstands 2008 brachen hier Proteste aus, nachdem Berichten zufolge ein Mönch im Kloster Kirti ein Bild des Dalai Lama hochgehalten hatte. Die Situation eskalierte schließlich zu einem Aufstand, und chinesische Truppen eröffneten das Feuer. Mindestens 18 Tibeter wurden in der kleinen Stadt getötet.
Während sich die Proteste in Tibet erhoben, kam es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen mit chinesischen Paramilitärs. Peking spricht von 22 Toten, während tibetische Exilgruppen die Zahl auf rund 200 beziffern.
In den folgenden Jahren kam es zu über 150 Selbstverbrennungen mit der Forderung nach der Rückkehr des Dalai Lama – die meisten davon in und um Aba. Dies brachte der Hauptstraße den düsteren Spitznamen „Märtyrerstraße“ ein.
Seitdem hat China sein Vorgehen verschärft, sodass es nahezu unmöglich ist, herauszufinden, was in Tibet oder den tibetischen Gebieten geschieht. Die Informationen, die es gibt, stammen von Menschen, die ins Ausland geflohen sind, oder von der indischen Exilregierung.

Um noch mehr zu erfahren, kehrten wir am nächsten Tag vor Sonnenaufgang zum Kloster zurück. Wir schlüpften an unseren „Aufsehern“ vorbei und gingen zurück nach Aba zum Morgengebet.
Die Mönche versammelten sich in ihren gelben Hüten, dem Symbol der Gelug-Schule des Buddhismus. Tiefe, klangvolle Gesänge hallten durch die Halle, während der Rauch des Rituals in der feuchten Luft hing. Etwa 30 einheimische Männer und Frauen, die meisten in traditionellen tibetischen Gewändern mit langen Ärmeln, saßen im Schneidersitz, bis eine kleine Glocke das Gebet beendete.
„Die chinesische Regierung hat die Luft in Tibet vergiftet. Sie ist keine gute Regierung“, sagte uns ein Mönch.
„Wir Tibeter haben keine grundlegenden Menschenrechte. Die chinesische Regierung unterdrückt und verfolgt uns weiterhin. Diese Regierung dient nicht dem Volk.“
Er gab keine Einzelheiten preis, und unsere Gespräche waren kurz, um Entdeckungen zu vermeiden. Trotzdem hört man solche Stimmen selten.
Die Frage nach Tibets Zukunft hat an Brisanz gewonnen, da der Dalai Lama diese Woche 90 Jahre alt wird. Hunderte seiner Anhänger versammelten sich in der indischen Stadt Dharamsala, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Am Mittwoch verkündete er seinen lang erwarteten Nachfolgeplan und bekräftigte damit seine bereits frühere Ankündigung: Der nächste Dalai Lama werde nach seinem Tod gewählt.
Tibeter auf der ganzen Welt reagierten – mit Erleichterung, Zweifel oder Angst – nicht jedoch diejenigen im Heimatland des Dalai Lama, wo es sogar verboten ist, seinen Namen zu flüstern.
Peking hat sich laut und deutlich geäußert: Die nächste Reinkarnation des Dalai Lama wird mit Zustimmung der Kommunistischen Partei Chinas in China stattfinden. Tibet hingegen schweigt.
„So ist es nun einmal“, sagte uns der Mönch. „Das ist die Realität.“
Zwei Welten unter einem Himmel

Die Straße nach Aba schlängelt sich von Sichuans Hauptstadt Chengdu aus fast 500 Kilometer langsam dahin.
Sie führt an den schneebedeckten Gipfeln des Mount Siguniang vorbei, bevor sie die Graslandschaften am Rande des tibetischen Plateaus erreicht.

Die schrägen, goldenen Dächer buddhistischer Tempel glänzen alle paar Kilometer und reflektieren das besonders helle Sonnenlicht. Es ist das sogenannte „Dach der Welt“, wo der Verkehr den Yakhirten auf ihren Pferden weicht, die ihrer widerstrebenden, grunzenden Herde etwas zupfeifen, während Adler über ihnen kreisen.
Unter diesem Himalajahimmel gibt es zwei Welten, in denen Tradition und Glaube mit der Forderung der Partei nach Einheit und Kontrolle kollidieren.
China hat lange behauptet, die Tibeter hätten die Freiheit, ihren Glauben auszuüben. Doch dieser Glaube ist auch die Quelle einer säkularen Identität, die Peking laut Menschenrechtsgruppen langsam untergräbt.
Sie behaupten, dass zahllose Tibeter festgenommen wurden, weil sie friedliche Proteste abgehalten, die tibetische Sprache gefördert oder sogar ein Porträt des Dalai Lama besessen hätten.
Viele Tibeter, darunter auch einige, mit denen wir im Kloster Kirti gesprochen haben, sind besorgt über die neuen Gesetze zur Ausbildung tibetischer Kinder.
Alle Minderjährigen unter 18 Jahren müssen nun chinesische staatliche Schulen besuchen und Mandarin lernen. Sie dürfen erst mit 18 Jahren buddhistische Schriften im Klosterunterricht studieren – und sie müssen „das Land und die Religion lieben und die nationalen Gesetze und Vorschriften befolgen“.
Dies stellt eine große Veränderung für eine Gemeinschaft dar, in der Mönche oft schon als Kinder rekrutiert wurden und Klöster für die meisten Jungen als Schulen dienten.

„Eine der nahegelegenen buddhistischen Einrichtungen wurde vor einigen Monaten von der Regierung zerstört“, erzählte uns ein etwa 60-jähriger Mönch aus Aba, der im Regen unter einem Regenschirm zum Gebet ging.
„Es war eine Schule des Predigens“, fügte er emotional hinzu.
Die neuen Regeln folgen einer Anordnung aus dem Jahr 2021, wonach in allen Schulen in tibetischen Gebieten, einschließlich Kindergärten, auf Chinesisch unterrichtet werden muss. Peking sagt, dies erhöhe die Chancen tibetischer Kinder auf einen Arbeitsplatz in einem Land, in dem Mandarin die Hauptsprache ist.
Doch diese Regelungen könnten einen „tiefgreifenden Einfluss“ auf die Zukunft des tibetischen Buddhismus haben, meint der renommierte Wissenschaftler Robert Barnett.
„Wir bewegen uns auf ein Szenario zu, in dem der chinesische Staatschef Xi Jinping die totale Kontrolle haben wird – auf eine Ära, in der nur wenige Informationen nach Tibet gelangen und die tibetische Sprache kaum noch weitergegeben wird“, sagt Barnett.
„Die Schulbildung wird sich fast ausschließlich auf chinesische Feste, chinesische Tugenden und die fortgeschrittene traditionelle chinesische Kultur konzentrieren. Wir sprechen hier von der vollständigen Verwaltung des intellektuellen Inputs.“
Die Straße nach Aba ist ein Beweis für das Geld, das Peking in diese abgelegene Ecke der Welt gepumpt hat. Eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke umrundet die Hügel und verbindet Sichuan mit anderen Hochplateauprovinzen.
In Aba wurden neben den traditionellen Straßenläden, die Mönchskutten und Weihrauchpäckchen verkaufen, neue Hotels, Cafés und Restaurants eröffnet, um Touristen anzulocken.

Chinesische Touristen kommen in ihrer Marken-Wanderkleidung an und stehen voller Ehrfurcht, während sich einheimische Gläubige am Eingang buddhistischer Tempel auf Holzkeulen niederwerfen.
„Wie schaffen sie es, den ganzen Tag etwas zu unternehmen?“, fragt ein Tourist laut. Andere drehen begeistert Gebetsmühlen und fragen nach den farbenfrohen Wandmalereien, die Szenen aus dem Leben Buddhas darstellen.
Ein am Straßenrand geschriebener Parteislogan prahlt damit, dass „Menschen aller ethnischen Gruppen so vereint sind wie die Kerne eines Granatapfels“.
Doch die umfassende Überwachung ist kaum zu übersehen.
Beim Einchecken in einem Hotel ist eine Gesichtserkennung erforderlich. Selbst beim Tanken sind mehrere Ausweisdokumente erforderlich, die von hochauflösenden Kameras vorgeführt werden. China kontrolliert seit langem den Zugang seiner Bürger zu Informationen – in tibetischen Gebieten sind die Kontrollen jedoch noch strenger.
Die Tibeter, sagt Barnett, seien „von der Außenwelt isoliert“.

Es ist schwer zu sagen, wie viele von ihnen von der Ankündigung des Dalai Lama am Mittwoch wissen – die in der ganzen Welt ausgestrahlt, in China jedoch zensiert wurde.
Der 14. Dalai Lama lebt seit 1959 im indischen Exil und plädiert für mehr Autonomie statt völliger Unabhängigkeit für sein Heimatland. Peking ist der Ansicht, er habe „kein Recht, das tibetische Volk zu vertreten“.
Er übergab die politische Macht im Jahr 2011 an eine Exilregierung, die von 130.000 Tibetern weltweit demokratisch gewählt wurde. Diese Regierung hat in diesem Jahr hinter den Kulissen Gespräche mit China über einen Nachfolgeplan geführt, aber es ist unklar, ob es dabei irgendwelche Fortschritte gab.
Der Dalai Lama hatte bereits angedeutet, sein Nachfolger werde aus der „freien Welt“, also außerhalb Chinas, kommen. Am Mittwoch sagte er: „Niemand hat mehr die Autorität, sich einzumischen.“
Damit ist der Boden für eine Konfrontation mit Peking bereitet, das erklärt hat, der Prozess müsse „religiösen Ritualen und historischen Gebräuchen folgen und im Einklang mit den nationalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen“.

Peking leiste bereits die nötige Vorarbeit, um die Tibeter zu überzeugen, sagt Barnett.
„Es gibt bereits einen riesigen Propagandaapparat. Die Partei hat Teams in Büros, Schulen und Dörfer geschickt, um die Menschen über die ‚neuen Regeln‘ für die Wahl des Dalai Lama zu unterrichten.“
Als der Penchen Lama, die zweithöchste Autorität des tibetischen Buddhismus, 1989 starb, bestimmte der Dalai Lama einen Nachfolger für dieses Amt in Tibet. Doch der Junge verschwand. Peking wird der Entführung des Kindes beschuldigt, betont jedoch, der inzwischen erwachsene Junge sei in Sicherheit. Inzwischen hat Peking einen anderen Penchen Lama anerkannt, den Tibeter außerhalb Chinas nicht anerkennen.
Wenn es zwei Dalai Lamas gäbe, könnte dies zu einer Bewährungsprobe für Chinas Überzeugungskraft werden. Welchen Dalai Lama würde die Welt anerkennen? Und was noch wichtiger ist: Wüssten die meisten Tibeter in China von der Existenz des anderen Dalai Lama?
China möchte einen glaubwürdigen Nachfolger – aber vielleicht niemanden, der wirklich glaubwürdig ist.
Denn laut Barnett will Peking „den Löwen der tibetischen Kultur in einen Pudel verwandeln“.
„Sie möchte Dinge entfernen, die sie für riskant hält, und sie durch Dinge ersetzen, über die die Tibeter ihrer Meinung nach nachdenken sollten: Patriotismus, Loyalität, Treue. Sie mögen das Singen und Tanzen – die Disney-Version der tibetischen Kultur.“
„Wir wissen nicht, wie lange es überleben wird“, schlussfolgert Barnett.


Als wir das Kloster verlassen, sehen wir eine Reihe von Frauen, die schwere Körbe voller Werkzeuge für das Baugewerbe und die Landwirtschaft tragen und durch den Gebetsmühlenraum gehen, wobei sie diese im Uhrzeigersinn drehen.
Sie singen auf Tibetisch und lächeln, wenn sie vorbeigehen, ihr graues Haar ist unter ihren Sonnenhüten gefaltet.
Die Tibeter haben 75 Jahre lang ihre Identität bewahrt, dafür gekämpft und sind dafür gestorben.
Die Herausforderung besteht nun darin, sie zu beschützen, auch wenn der Mann, der ihre Überzeugungen – und ihre Widerstandskraft – verkörpert, nicht mehr da ist.
 BBC News Brasil – Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung von BBC News Brasil ist untersagt.
BBC News Brasil – Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung von BBC News Brasil ist untersagt.
terra