Eduardo Mendoza: Die Welt überraschen und zu Hause ertrinken

Eine Art Meinungsbeitrag, der ein kulturelles oder unterhaltsames Werk ganz oder teilweise beschreibt, lobt oder kritisiert. Er sollte immer von einem Experten auf dem jeweiligen Gebiet verfasst sein.

Der vielleicht herausragendste Roman der kürzlich mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis ausgezeichneten Autorin , „Die Stadt der Wunder“ , beschreibt anhand des urbanen Setting die Verwandlung einer Provinzstadt in eine kosmopolitische Metropole. Er beleuchtet auch die Spannungen zwischen Madrid und Barcelona und die Ursprünge der Verachtung, ja des Hasses, den ein großer Teil der Barcelonaer Bürger gegenüber den Bourbonen hegte. Ein Stadtpark kann all dies erzählen.
„Am Vorabend der Eröffnung der Weltausstellung hatten die Behörden versprochen, Barcelona von unerwünschten Personen zu befreien.“ Derselbe Satz, den Mendoza auf das Jahr 1888, kurz vor der Eröffnung der ersten Weltausstellung in seiner Stadt – und in Spanien – datiert, war in Barcelona mehrmals zu hören. Nicht zufällig geschah dies während der Vorbereitungen für ein anderes Großereignis, das die Metropole verändern sollte: die Olympischen Spiele 1992. Bei dieser Gelegenheit wurden die Transvestiten, mit denen wir uns nachts auf der Rambla de Catalunya tummelten, und die Prostituierten, die von geringerem Ansehen und geringerem Budget als die in Pedralbes waren und am Ende der Ramblas arbeiteten, vertrieben.
Wir wissen, dass es Jahre dauert, die Olympischen Spiele zu finanzieren. Vor allem, wenn es bei einer der Nationalsportarten darum geht, alles zu geben und seine Macht zu demonstrieren. In Vorbereitung auf die zweite Weltausstellung, die 1929 erneut in Barcelona stattfand, berichtet Mendoza, dass „alle zwei Stunden so viel Wasser benötigt wurde, wie die gesamte Stadt Barcelona an einem Tag verbrauchte“. Für diese zweite Weltausstellung in Barcelona – die zweite in Spanien und in derselben Stadt – gab es in der Stadt ein griechisches Theater (El Grec), ein spanisches Dorf (mit traditionellen Gebäuden aus verschiedenen spanischen Provinzen) und … eines der modernsten Gebäude der Welt: den Deutschen Pavillon, der heute rekonstruiert und nach seinem Architekten Mies van der Rohe benannt ist. „Alles auf einmal“, schreibt er.
Doch für Mendoza war das vielleicht auffälligste Merkmal dieser Weltausstellung der leuchtende Springbrunnen, „der Springbrunnen an einem Hang des Berges Montjuich , ein Becken mit 50 Metern Durchmesser und 3.200 Kubikmetern Fassungsvermögen, umgeben von Fontänen, die 3.000 Liter Wasser bewegten, angetrieben von fünf 1.175 PS starken Pumpen und beleuchtet von 1.300 Kilowatt Strom. Er veränderte Form und Farbe. Jeder konnte ihn sehen. Er überraschte die Welt und ertränkte Menschen zu Hause.“
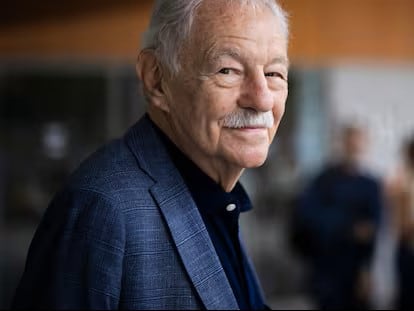
Barcelona erstickte im 19. Jahrhundert. Das Hauptproblem war … der Wohnungsmangel. Die Immobilienpreise schossen ins Unermessliche, weil die Stadt von den antiken römischen Mauern eingeschlossen war. Während Paris über 7.802 Hektar und London über 31.685 Hektar verfügte, lebten die Einwohner Barcelonas auf 427 Hektar. Mendoza berichtet, dass die Einwohnerdichte in Paris 291 und in London 128 Einwohner pro Quadratkilometer betrug, während in Barcelona 700 Menschen auf diesem Gebiet lebten, „weil die Regierung den Abriss der Mauern nicht erlaubte und Barcelona mit unhaltbaren strategischen Vorwänden daran hinderte, an Größe und Macht zu wachsen“, schreibt er. Woher stammt dieser Verdacht, der so aktuell zu sein scheint? Mendoza bringt ihn in seinem großartigen Roman zum Ausdruck.
„1701 unterstützte Katalonien, eifersüchtig auf seine Freiheiten, die es bedroht sah, im Spanischen Erbfolgekrieg die Seite des Erzherzogs von Österreich. Nachdem diese Fraktion besiegt und das Haus Bourbon in Spanien inthronisiert worden war, wurde Katalonien bestraft.“ Die Armeen der Bourbonen plünderten Katalonien. „Dies geschah mit stillschweigender Zustimmung der lokalen Führer“, erklärt der Cervantes-Preisträger. Worin bestand die Plünderung?
Es gab Hunderte von Hinrichtungen, „als Hohn und Lehre; ihre Köpfe wurden auf Spieße aufgespießt und in den bevölkerungsreichsten Gegenden des Fürstentums zur Schau gestellt. Viele bestellte Felder wurden dem Erdboden gleichgemacht und mit Salz bestreut, um das Land unfruchtbar zu machen; Obstbäume wurden entwurzelt.“ Man versuchte, das Vieh auszurotten, insbesondere das Pyrenäenrind. Einige flohen in die Berge. Burgen wurden zerstört und ihre Quadersteine zur Umfassung der Mauern einiger Städte verwendet. Denkmäler auf Plätzen und Alleen wurden zertrümmert und zu Staub gemacht. Die Universität von Barcelona wurde geschlossen. Der Hafen wurde mit Haien gefüllt, die von den Antillen gebracht wurden. „Vielleicht wird diese Lektion den Katalanen nicht genügen“, sagte Philipp V. Dieser aufgeklärte Monarch, Herzog von Anjou, ließ in Barcelona eine gigantische Festung errichten. In der Zitadelle residierte eine Besatzungsarmee, bereit, jeden Aufstand niederzuschlagen. Dort wurden Aufrührer verdächtigt, gehängt und den Geiern zum Fraß vorgeworfen. Aber ... „Inaktive Soldaten sind immer eine Gefahr: Sie langweilen sich, werden nicht befördert und bleiben zu lange im Dienst.“ Paradoxe des Lebens: Gefangene der Pflicht und des Hasses, lebten die Soldaten eingesperrt in ihrer Zitadelle.
1848 kam es zu einem Volksaufstand. Espartero hielt es für zweckmäßiger, Barcelona vom Montjuïc-Hügel aus zu bombardieren, und die Stadt eroberte das Gelände der Zitadelle zurück. „Die Stadt der Wunder“ erzählt, wie dort für die Weltausstellung von 1888 ein öffentlicher Park angelegt wurde. Heute tagt dort das katalanische Parlament . Der Park ist ein Symbol. Auch ein Wahrzeichen. Er stellt eine historische Auslöschung und zugleich eine Berichtigung dar. Ebenso spricht der Autor – der mit Kritik nicht spart – von der „Rachsucht der Vorstellungskraft, die unsere lokale Verwaltung oft kennzeichnet“. Es gibt dort keine Wälder oder großen Haine. Es gibt eine Vergangenheit, Geschichte, Erklärungen. Und paradoxerweise Überreste der ersten spanischen Weltausstellung, die Barcelona in die „Stadt der Wunder“ verwandelte .
EL PAÍS



